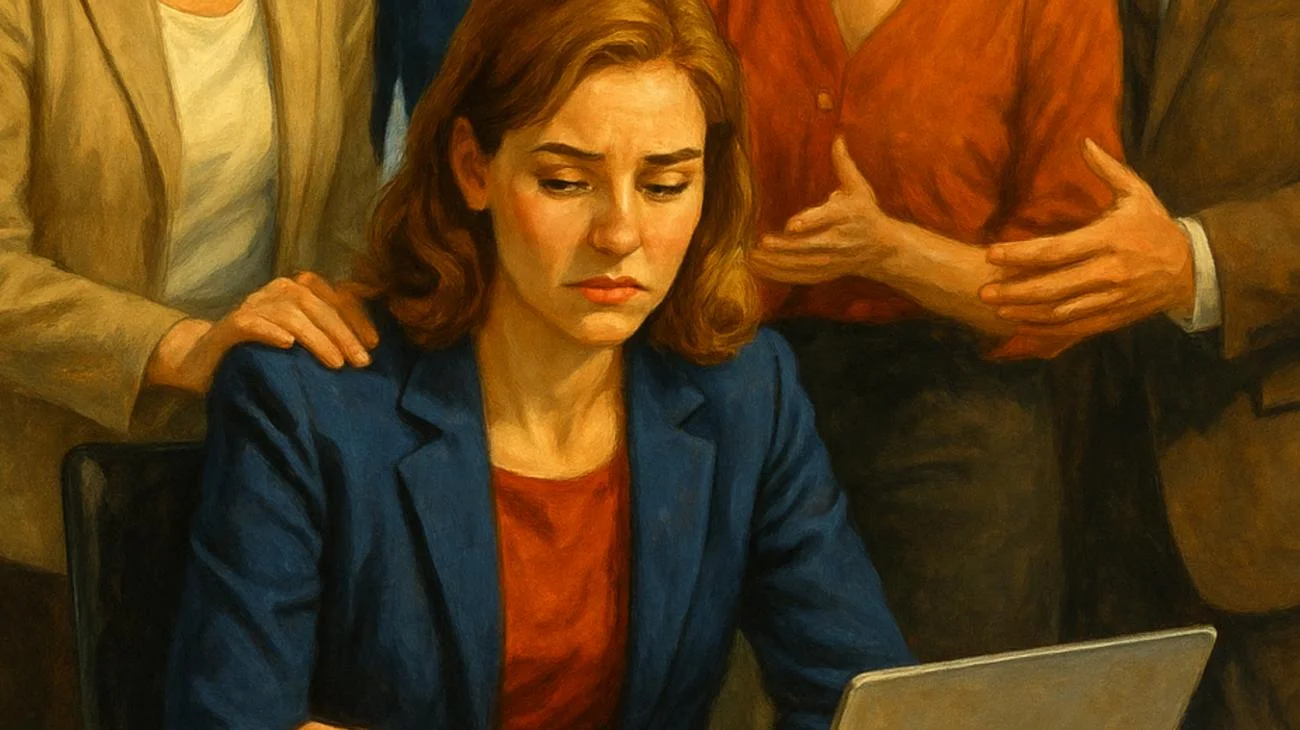Warum manche Menschen am Arbeitsplatz das Impostor-Syndrom entwickeln, laut Psychologie
Du sitzt in einem Meeting. Dein Chef lobt deine letzte Präsentation. Alle nicken anerkennend. Und während die Worte noch im Raum hängen, schießt dir nur ein Gedanke durch den Kopf: „Wenn die wüssten, dass ich eigentlich keine Ahnung habe.“ Willkommen im surrealen Universum des Impostor-Syndroms, wo erfolgreiche Menschen sich wie Betrüger fühlen und Komplimente wie Zeitbomben wirken, die jeden Moment ihre vermeintliche Inkompetenz enthüllen könnten.
Das Verrückte daran? Du bist nicht allein. Ungefähr 70 Prozent aller Menschen erleben dieses Phänomen irgendwann in ihrem Leben. Das bedeutet, dass statistisch gesehen sieben von zehn Personen in deinem Büro, deinem Zoom-Call oder deinem LinkedIn-Feed heimlich denken, sie hätten ihren Job nur durch eine kosmische Verwechslung bekommen. Bei weiblichen Führungskräften liegt die Quote sogar bei erschreckenden 75 Prozent. Das ist keine kleine Randgruppe – das ist praktisch die Mehrheit der Arbeitswelt.
Was zum Teufel ist das Impostor-Syndrom überhaupt?
Lass uns eines klarstellen: Das Impostor-Syndrom ist keine offizielle psychiatrische Störung. Du findest es nicht im DSM-5 zwischen Depression und Panikstörung. Es ist vielmehr ein psychologisches Muster, ein kognitiver Bias, der dein Gehirn dazu bringt, deine eigenen Leistungen systematisch zu entwerten. Menschen, die davon betroffen sind, schaffen es irgendwie, trotz harter Fakten – Abschlüsse, Beförderungen, positive Leistungsbeurteilungen – fest davon überzeugt zu sein, dass sie Hochstapler sind.
Der Mechanismus dahinter ist ein klassischer Attributionsfehler. Das ist der psychologische Fachbegriff dafür, wie wir Ereignisse erklären. Bei Menschen mit Impostor-Syndrom läuft das System komplett schief: Erfolge werden externen Faktoren zugeschrieben – Glück, Timing, nette Kollegen, günstige Umstände. Misserfolge hingegen? Die sind natürlich komplett selbstverschuldet und der unwiderlegbare Beweis für die eigene Unfähigkeit. Es ist wie ein manipuliertes Spiel, bei dem du nur verlieren kannst, weil dein eigenes Gehirn die Regeln gegen dich gedreht hat.
Das Resultat? Betroffene leben in einem permanenten Zustand der Anspannung. Sie überarbeiten sich chronisch, um bloß keine Schwäche zu zeigen. Sie lehnen Beförderungen ab, weil sie überzeugt sind, nicht qualifiziert genug zu sein. Manche wechseln häufig den Job, bevor jemand angeblich ihre Unfähigkeit entdeckt. Und das Ganze korreliert nachweislich mit Burnout, Angststörungen und Depressionen. Das ist nicht nur unangenehm – das ist ernsthaft belastend.
Die Pandemie hat alles noch schlimmer gemacht
Falls du dachtest, Homeoffice und Zoom-Meetings würden die Sache erleichtern, habe ich schlechte Nachrichten. LinkedIn-Umfragen aus den Jahren 2021 und 2022 zeigen, dass während der Pandemie bis zu 31 Prozent der Befragten verstärkt unter Selbstzweifeln am Arbeitsplatz litten. Besonders hart traf es junge Menschen und Frauen.
Das macht auch total Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Im Büro siehst du deine Kollegen kämpfen, frustriert sein, Fehler machen. Du siehst die Realität hinter der Fassade. Im Homeoffice? Da siehst du nur perfekt ausgeleuchtete Zoom-Kacheln, in denen alle scheinbar kompetent und zusammengerissen wirken. Du siehst nicht, dass deine Kollegin drei Anläufe für ihre Präsentation gebraucht hat oder dass dein Chef in Jogginghose unter dem Schreibtisch sitzt. Diese Isolation verstärkt die Illusion, dass alle anderen mühelos erfolgreich sind, während nur du allein kämpfst.
Social Media gießt dann noch zusätzlich Öl ins Feuer. Wir konsumieren ständig die Highlight-Reels anderer Menschen – die Beförderungen, die Auszeichnungen, die perfekten Karrieremomente. Was wir nicht sehen, sind die hundert Absagen davor, die schlaflosen Nächte oder die Momente lähmender Selbstzweifel. Das schafft eine komplett verzerrte Realität.
Warum ausgerechnet die Erfolgreichen betroffen sind
Hier kommt der wirklich bizarre Teil: Das Impostor-Syndrom trifft besonders häufig Menschen in hochqualifizierten Jobs. Etwa 62 Prozent der Wissensarbeiter – also Leute in intellektuell anspruchsvollen Berufen – sind betroffen. Das sind nicht irgendwelche Durchschnittsverdiener, die vor sich hin dümpeln. Das sind Ärzte, Anwälte, Softwareentwickler, Manager, Forscher. Menschen, die objektiv betrachtet verdammt gut in dem sind, was sie tun.
Warum ausgerechnet diese Gruppe? Mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Erstens: Mit jedem Karriereschritt wird die Vergleichsgruppe kleiner und elitärer. Wenn du plötzlich in einem Raum mit den Besten deiner Branche sitzt, ist die Frage „Gehöre ich wirklich hierher?“ ziemlich natürlich. Der Unterschied ist nur: Menschen ohne Impostor-Syndrom beantworten die Frage mit „Ja, sonst wäre ich nicht hier“, während Betroffene sich sicher sind, dass ihre Anwesenheit ein kosmischer Fehler ist.
Zweitens kennen erfolgreiche Menschen ihre eigene holprige Geschichte. Sie erinnern sich an jeden Fehler, jeden Moment der Unsicherheit, jede Phase, in der sie nicht wussten, was sie taten. Für Außenstehende sieht ihr Erfolg mühelos aus, aber sie selbst kennen die Realität dahinter. Das Problem ist, dass sie diese normalen Lernprozesse als Beweis ihrer Unzulänglichkeit interpretieren, statt als das, was sie sind: der ganz normale Weg zum Erfolg.
Drittens bedeuten hochqualifizierte Berufe oft ständige neue Herausforderungen. Ein Softwareentwickler muss sich in neue Programmiersprachen einarbeiten, eine Managerin mit völlig neuen Geschäftsfeldern umgehen. Das Gefühl, nicht alles zu wissen, ist permanent präsent. Für Menschen ohne Impostor-Syndrom ist das spannend. Für Betroffene fühlt es sich an wie der ultimative Beweis, dass sie eigentlich keine Ahnung haben.
Der Perfektionismus-Fluch
Wenn wir über die Ursachen des Impostor-Syndroms sprechen, müssen wir über Perfektionismus reden. Das ist einer der größten Treiber dieses psychologischen Musters. Menschen mit Impostor-Syndrom setzen sich selbst völlig unrealistische Standards. Ihr innerer Maßstab für Erfolg ist nicht „gut“ oder sogar „sehr gut“ – es ist „absolut perfekt, auf Anhieb, ohne Hilfe, ohne Fehler“.
Das Problem? Niemand arbeitet so. Auch die erfolgreichsten Menschen der Welt machen Fehler, brauchen mehrere Anläufe, lernen unterwegs dazu. Aber für jemanden mit perfektionistischen Tendenzen und Impostor-Syndrom sind diese normalen menschlichen Prozesse keine Zeichen von Wachstum, sondern Beweis des Scheiterns. Sie denken: „Wenn ich wirklich kompetent wäre, hätte ich das sofort perfekt gemacht.“ Spoiler: So funktioniert die Realität nicht.
Dieser Perfektionismus führt zu chronischer Überarbeitung. Betroffene glauben, wenn sie nur hart genug arbeiten, können sie ihre vermeintliche Unzulänglichkeit kompensieren. Sie arbeiten bis zur Erschöpfung, während sie gleichzeitig überzeugt sind, nicht genug zu tun. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Sie brennen aus, fühlen sich leer und ausgelaugt, und interpretieren diese Erschöpfung als weiteren Beweis ihrer Schwäche. Es ist ein perfider Teufelskreis.
Der Vergleichswahn zerstört dich von innen
Soziale Vergleiche sind absolutes Gift für Menschen mit Impostor-Syndrom. Wir alle vergleichen uns bis zu einem gewissen Grad mit anderen – das ist menschlich. Aber für Betroffene wird dieser Vergleich zum permanenten Beweis ihrer Minderwertigkeit. Die Kollegin scheint Präsentationen mühelos aus dem Ärmel zu schütteln? Beweis, dass du unfähig bist. Der Kollege bekommt ein Lob vom Chef? Beweis, dass du nicht gut genug bist.
Was diese Menschen nicht sehen, ist die Realität hinter der Fassade. Sie sehen nicht, dass die Kollegin drei Nächte an der Präsentation gearbeitet hat und kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Sie sehen nicht, dass der Kollege auch regelmäßig kritisiert wird, aber das eben nicht auf LinkedIn postet. Sie sehen nur die polierten Außenseiten und vergleichen sie mit ihrem eigenen chaotischen Innenleben. Das ist, als würde man sein Behind-the-Scenes mit den Highlight-Reels anderer vergleichen – natürlich verliert man da.
Was das Phänomen über Selbstwert verrät
Wenn wir tiefer graben, enthüllt das Impostor-Syndrom etwas Fundamentales über die Beziehung einer Person zu ihrem Selbstwert. Menschen, die darunter leiden, haben ihren Wert oft komplett an externe Validierung geknüpft. Ihr Selbstbild hängt davon ab, was andere über sie denken, wie sie von außen bewertet werden, welche Anerkennung sie bekommen.
Das Problem mit externer Validierung? Sie ist wie Treibsand – sie gibt nie dauerhaften Halt. Egal wie viel Lob du bekommst, egal wie viele Auszeichnungen du sammelst, die innere Stimme flüstert immer: „Das zählt nicht wirklich. Die wissen nur nicht, wie du wirklich bist. Wenn sie die Wahrheit kennen würden, wären sie enttäuscht.“ Diese Diskrepanz zwischen äußerer Anerkennung und innerem Erleben kann absolut lähmend sein.
Betroffene leben praktisch in zwei parallelen Realitäten: In der einen sind sie kompetente Profis, die ihren Job machen und Anerkennung bekommen. In der anderen sind sie verzweifelte Hochstapler, die kurz vor der Entdeckung stehen. Dieser psychologische Spagat verursacht enormen Stress und kann zu ernsthaften mentalen Gesundheitsproblemen führen. Die Forschung zeigt klare Korrelationen zwischen dem Impostor-Syndrom und erhöhten Raten von Angststörungen, Depressionen und Burnout.
Wie man aus diesem Hamsterrad aussteigt
Die gute Nachricht in diesem ganzen Chaos? Das Impostor-Syndrom ist zwar weit verbreitet, aber nicht unüberwindbar. Der erste und wichtigste Schritt ist Bewusstsein. Zu erkennen, dass diese Gedankenmuster existieren und nicht objektive Realität sind, ist entscheidend. Dein Gefühl, ein Hochstapler zu sein, ist nicht die Wahrheit – es ist ein kognitiver Bias, eine Verzerrung deiner Wahrnehmung.
Ein konkreter Ansatz besteht darin, Erfolge bewusst zu internalisieren. Wenn etwas gut läuft, zwinge dich dazu zu sagen: „Ich habe das durch meine Fähigkeiten und meine Arbeit geschafft“, statt automatisch auf Glück oder externe Umstände zu verweisen. Ja, das fühlt sich am Anfang komisch an, fast wie Angeberei. Aber es ist notwendig, um das verzerrte Attributionsmuster zu durchbrechen. Du trainierst dein Gehirn, Erfolge korrekt zuzuordnen – nämlich zu dir selbst.
Ein weiterer hilfreicher Schritt ist das Teilen deiner Erfahrungen. Sprich mit vertrauten Kollegen über deine Selbstzweifel. Du wirst vermutlich überrascht sein, wie viele von ihnen nicken und sagen: „Mir geht es genauso.“ Diese Normalisierung nimmt dem Phänomen viel von seiner Macht. Plötzlich bist du nicht mehr der einzige Hochstapler in einem Raum voller Genies – du bist ein normaler Mensch in einem Raum voller normaler Menschen, die alle manchmal zweifeln.
Das Überdenken von Perfektionismus ist ebenfalls zentral. Akzeptiere, dass „gut genug“ oft tatsächlich gut genug ist. Dass Lernen Fehler einschließt. Dass niemand – wirklich absolut niemand – alles perfekt kann. Die erfolgreichsten Menschen sind nicht diejenigen, die nie scheitern. Es sind diejenigen, die aus Fehlern lernen, sich wieder aufrappeln und weitermachen. Fehler sind keine Beweise deiner Unfähigkeit – sie sind Beweise dafür, dass du dich traust, neue Dinge auszuprobieren.
Manche finden es hilfreich, ihre Erfolge systematisch zu dokumentieren. Führe eine Liste oder ein Journal, in dem du konkret festhältst, was du erreicht hast – nicht um anzugeben, sondern um dir selbst vor Augen zu führen, dass deine Erfolge real und verdient sind. Wenn die Zweifel zurückkommen, und sie werden zurückkommen, hast du schwarz auf weiß den Beweis, dass du kompetent bist.
Die unbequeme Wahrheit über unsere Arbeitskultur
Wenn wir ehrlich sind, enthüllt das Impostor-Syndrom auch eine ziemlich unbequeme Wahrheit über unsere Arbeitskultur. Wir haben Systeme geschaffen, in denen sich selbst die kompetentesten Menschen permanent unsicher fühlen. Wir glorifizieren mühelose Brillanz, verstecken unsere Kämpfe hinter professionellen Fassaden und präsentieren Erfolg als linearen Aufstieg, obwohl die Realität chaotisch und voller Rückschläge ist.
Diese Kultur des Nicht-Zeigens von Schwäche, des permanenten Performens, des Versteckens von Unsicherheiten – sie nährt das Impostor-Syndrom. Wenn niemand zugibt zu kämpfen, glaubt jeder, er sei der Einzige. Wenn alle ihre Erfolge als mühelos darstellen, denkt jeder, der Schwierigkeiten hat, er sei unfähig. Wir haben eine kollektive Illusion geschaffen, in der alle so tun, als hätten sie alles im Griff, während heimlich die Mehrheit zweifelt.
Das Phänomen zeigt auch, wie tief verwurzelt unsere Vorstellungen von Wert und Anerkennung sind. In einer Gesellschaft, die Leistung über alles stellt, ist es kein Wunder, dass Menschen ihren gesamten Selbstwert daran knüpfen, ob sie als kompetent wahrgenommen werden. Wir definieren uns über unsere Jobs, unsere Erfolge, unsere LinkedIn-Profile. Und wenn wir dann in diesem Bereich zweifeln, zweifeln wir an unserem gesamten Wert als Person.
Vielleicht wäre es an der Zeit, dass Unternehmen und Führungskräfte offener über ihre eigenen Unsicherheiten sprechen. Dass sie zeigen, dass auch sie nicht alles wissen, dass auch sie manchmal scheitern, dass auch sie lernen müssen. Eine Kultur, die Verletzlichkeit zulässt und Lernen über Perfektion stellt, könnte dem Impostor-Syndrom viel von seiner Macht nehmen. Denn wenn es normal ist zu kämpfen, wenn es okay ist, nicht alles zu wissen, dann muss sich niemand mehr wie ein Betrüger fühlen, nur weil er menschlich ist.
Die 70 Prozent der Menschen, die irgendwann in ihrem Leben dieses Syndrom erleben, sind nicht schwach oder unfähig. Sie sind das Produkt einer Arbeitskultur, die unrealistische Erwartungen stellt und gleichzeitig die Realität hinter Erfolg verschleiert. Das zu erkennen ist keine Ausrede – es ist der erste Schritt zu echtem Wandel, sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene. Denn am Ende geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, authentisch und menschlich sein zu dürfen – auch und gerade am Arbeitsplatz.
Inhaltsverzeichnis